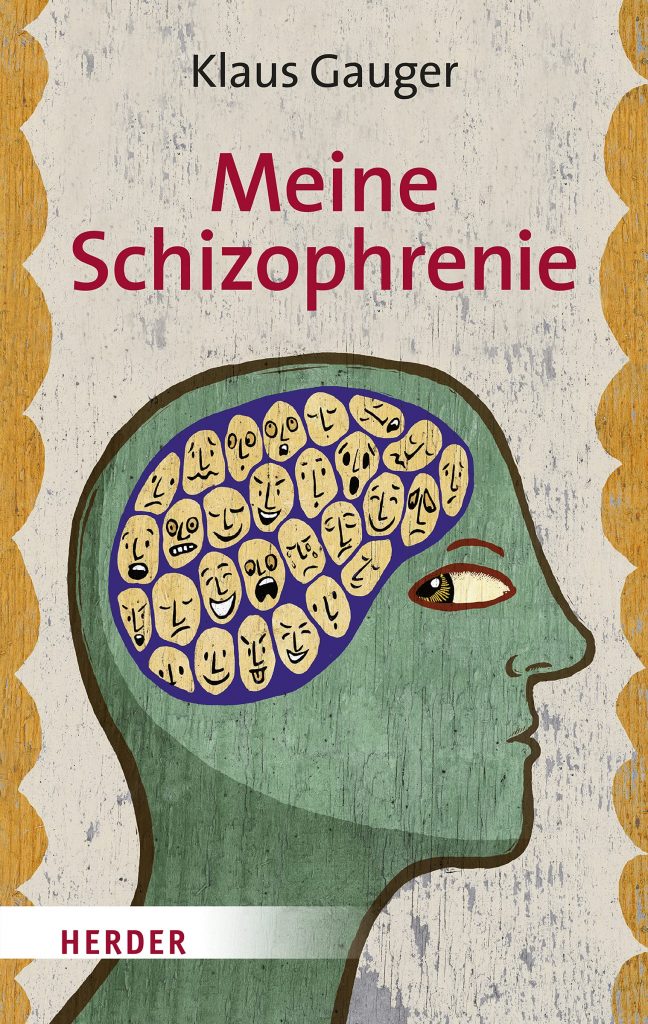
„Viele Schizophreniebetroffene erleben die erste Zwangseinweisung und -behandlung als tiefen Bruch in ihrem Leben – eine Wunde, die nur schwer verheilt. Auch bei ihnen teilt sich das Leben seit diesem Ereignis in ein normales und oft erfolgreiches Leben vor der Psychose und ein problematisches und von beruflichen, sozialen und persönlichen Defiziten geprägtes Leben danach.“ (Seite 45)
Klaus Gauger erzählt in Meine Schizophrenie von seiner Kindheit und Jugend, von seiner Schulzeit und seinem Studium, von der Zäsur im jungen Erwachsenenalter, als er nach einer mehrjährigen Prodromalphase seine erste psychotische Episode erlebt, von Drogen und Vulnerabilitäts-Stress-Modell, von Psychopharmakotherapie und Psychotherapie, von Wahn und seinem rastlosen Reisen durch mehrere Länder.
Gauger beschreibt sehr detailliert seine psychotischen Episoden, gibt so Einblicke in seine Gedanken, seine Gefühle, sein Erleben und seine Wahrnehmung in der Psychose. Aufgrund dieser Aspekte kann ich das Buch sehr empfehlen, denn Gauger klärt durch seine Offenheit auf und entstigmatisiert dadurch. Sehr gelungen fand ich auch, dass er häufiger auf die Funktionalität von Wahn eingeht, und dass er dies sehr gut herausgearbeitet hat. Gefallen hat mir außerdem, dass sich das Buch sehr flüssig und schnell lesen lässt, Gaugers Ausführungen eine gute Mischung aus Fakten und eigenen Erfahrungen sind und dass er sehr viel Wissen über Psychosen vermittelt.
Auch die Schilderungen seines ersten Psychiatrie-Aufenthaltes empfand ich als sehr bewegend: Solche Zustände kenne ich leider auch noch aus dem 1990ern. Ich kann aber sagen, dass sich mittlerweile sehr viel zum Besseren gewendet hat, zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewege.
Trotz der vielen positiven Aspekte werde ich das Buch nur dann an Betroffene/Angehörige weiterempfehlen, wenn meine Empfehlung von ein paar Relativierungen und Erklärungen begleitet ist und ich zudem neuere Entwicklungen zum Thema Psychose zur Sprache bringen kann. Gaugers Sicht auf Psychosen ist sehr stark biologisch geprägt. Das mag für ihn ein geeignetes und gutes Ätiologiemodell sein, aber ich finde es einerseits zu pauschal und andererseits nicht up-to-date. Ich finde es gut und nützlich, dass er der Psychopharmakotherapie mit seinem Buch etwas den Schrecken nehmen kann, aber bei der Behandlung nur auf Antipsychotika zu setzen, finde ich zu kurz gedacht. Er blickt aufgrund der eigenen Erfahrungen sehr pessimistisch auf Psychotherapie, und ich fände es schade und tragisch, wenn Leser des Buches deshalb keine Psychotherapie in Betracht ziehen (obwohl die S3-Leitlinie für Schizophrenie z.B. eine klare Empfehlung für Verhaltenstherapie ausspricht und es im Bereich der Psychosenpsychotherapie sehr viele neue und gute Entwicklungen gibt).
Auch empfand ich Gauger oft als zu negativ, was die Prognose der Schizophrenie angeht (z.B. auf Seite 53: „In der Regel nimmt die Schizophrenie leider einen chronischen Verlauf.“). Ich finde Hoffnung und das (authentische!) Vermitteln von Hoffnung extrem wichtig, denn nur so entsteht die Motivation, Dinge zu ändern, an bestimmten Themen zu arbeiten, weiter aktiv am Behandlungsprozess teilzunehmen. Natürlich ist es wichtig, realistisch zu bleiben, aber der Verlauf der Schizophrenie ist eben nicht in der Regel chronisch. Und was bleibt, wenn es keine Hoffnung mehr gibt? Führt das nicht gezwungenermaßen zu Resignation und Rückzug – und damit möglicherweise zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung?
Klaus Gauger: Meine Schizophrenie. Herder, 2018, 232 Seiten; 22 Euro.
