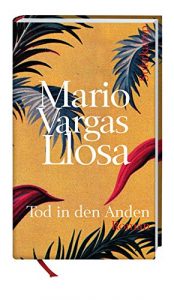 Drei Menschen sind in den peruanischen Anden spurlos verschwunden: der stumme Pedro Tinoco, der Albino Casimiro Huarcaya und Demetrio Chanca, der Vorarbeiter der Sprengbohrer. Korporal Lituma und sein Amtshelfer Tomás sollen das Verschwinden dieser Männer aufklären und sitzen aus diesem Grunde in Naccos fest. Dort ist das Leben nicht gerade einfach: Die Dorfbewohner sind misstrauisch, Terroristen machen die Umgebung unsicher, und unheimliche Geschichten werden erzählt.
Drei Menschen sind in den peruanischen Anden spurlos verschwunden: der stumme Pedro Tinoco, der Albino Casimiro Huarcaya und Demetrio Chanca, der Vorarbeiter der Sprengbohrer. Korporal Lituma und sein Amtshelfer Tomás sollen das Verschwinden dieser Männer aufklären und sitzen aus diesem Grunde in Naccos fest. Dort ist das Leben nicht gerade einfach: Die Dorfbewohner sind misstrauisch, Terroristen machen die Umgebung unsicher, und unheimliche Geschichten werden erzählt.
Sprachlich exzellent und psychologisch fundiert berichtet Mario Vargas Llosa von der allgegenwärtigen Gewalt in den peruanischen Anden: Die maostische Gruppierung des „Leuchtenden Pfades“ (Sendero Luminosa) verbreitet Angst und Schrecken, steinigt Touristen, eliminiert jeden, der ein Feind ihrer Bewegung zu sein scheint. Der Staat schlägt mit ähnlicher Gewalt zurück, im Irrglauben, dem Terror dadurch Einhalt gebieten zu können. Die Dorfbewohner massakrieren einander. Und die Indios versuchen, mit Gewalt und brutalen Opferungen die gewalttätige Natur zu besänftigen. Die Gewalt, die Trostlosigkeit und die düstere Stimmung ziehen sich durch das gesamte Buch und entwerfen dadurch ein ebenso beängstigendes wie beeindruckendes und faszinierendes Bild Perus.
Auch stilistisch ist Vargas Llosa ein Meisterwerk gelungen, bei dem durch die vermischten Dialoge im Sinne einer Parallelmontage, wie man sie aus Filmen kennt, die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verwischen.
Tod in den Anden lässt den Leser mit Lituma und Tomás in den Anden sitzen und auf den Überfall der Guerrilleros warten. Fesselnd, düster, sprachlich und stilistisch meisterhaft.
Mario Vargas Llosa: Tod in den Anden. Aus dem Spanischen von Elke Wehr. Suhrkamp, 2011, 420 Seiten; 10 Euro.
Dieser Post ist Teil des Berge-Monatsthemas im Januar 2019.
